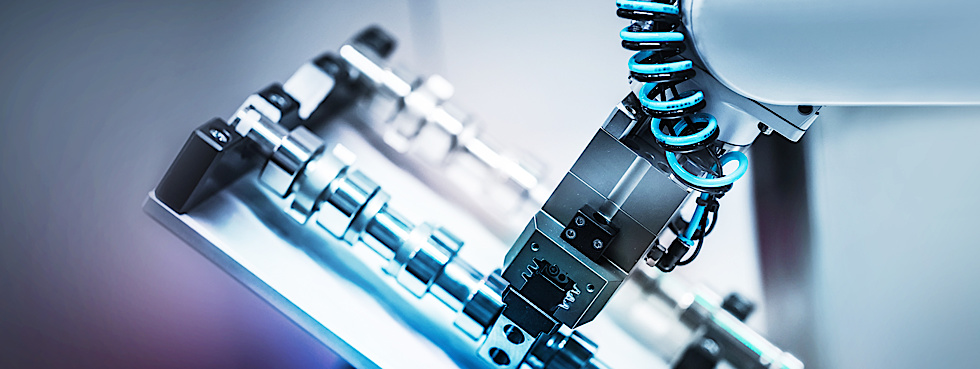Barta: „Die schleichende Aushöhlung des Industriestandorts hätte gravierende Auswirkungen auf Beschäftigung und Wohlstand“
Noch finden Innovationen und Innovationsprozesse der heimischen Metall- und Elektroindustrie (M+E) überwiegend am Standort Deutschland statt. Doch die Innovationskerne dieser Schlüsselindustrie beginnen auch aufgrund sich verschlechternder Standortbedingungen zu bröckeln und ins Ausland abzuwandern. Fast die Hälfte der Unternehmen plant, ihre Innovationsaktivitäten im Ausland künftig zu intensivieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie zweier Steinbeis-Transferzentren im Auftrag des Arbeitgeberverbands Südwestmetall. „Die Ergebnisse der Studie bestätigen unsere Befürchtungen und sind ein deutliches Alarmsignal“, sagte Oliver Barta, Hauptgeschäftsführer des Verbands bei der Vorstellung der Studie am Freitag in Stuttgart: „Gelingt es nicht, diese Entwicklung aufzuhalten, droht eine schleichende Aushöhlung des Industriestandorts mit gravierenden Folgen für Beschäftigung und Wohlstand in unserem Land.“
Für die Studie „Industrielle Innovationskerne am Standort Deutschland“ wurden 240 Unternehmen aus der M+E-Industrie, größtenteils in Baden-Württemberg, befragt. „Deutschland bleibt organisatorisches und technologisches Zentrum, verliert aber operative Tiefe und Exklusivität“, fasst Autor Prof. Dr. Christoph Zanker, Leiter des Steinbeis Transferzentrums „Industrielles Innovations- und Transformationsmanagement“ (Nürtingen), die Ergebnisse zusammen. „Insbesondere produktionsnahe Innovationsaktivitäten, aber auch produktseitige Entwicklungsprozesse, verschieben sich zunehmend ins Ausland. Für die mittel- bis langfristige Erosion der industriellen Innovationskerne bestehen daher erste Anzeichen“, ergänzt Co-Autor Prof. Dr. Steffen Kinkel, Leiter des Steinbeis Transferzentrums „Vernetzte Wertschöpfung und Innovation“ (Karlsruhe).
„Deutschland und Baden-Württemberg können dabei weiterhin auf Stärken wie hohe Qualifikation der Fachkräfte, einen verlässlichen Schutz geistigen Eigentums, politische Stabilität, eine ausgeprägte Innovationskultur sowie effiziente Innovationsprozesse bauen“, so Kinkel. Dafür müssten sich jedoch die Rahmenbedingungen am Standort ändern. „Ohne deutliche Verbesserungen bei digitaler Infrastruktur, Genehmigungs- und Planungsgeschwindigkeit sowie Zugang zu qualifizierten Fachkräften droht eine schleichende Verlagerung produktionsnaher Innovationsphasen“, sagte Zanker.
Für Südwestmetall-Hauptgeschäftsführer Barta kommt der Befund nicht völlig überraschend. Schon seit rund 25 Jahren sei zu beobachten, dass einfache Tätigkeiten der industriellen Wertschöpfung zunehmend von Baden-Württemberg ins Ausland verlagert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit auf der Kostenseite zu erhalten: „Damit einher ging unsere Befürchtung, dass in der Folge ein Dominoeffekt eintritt und sukzessive weitere Teile der Wertschöpfungsketten verlagert werden, an deren Ende dann Forschung und Entwicklung stehen. Wenn dieser Kernfraß nun das Herzstück unserer Industrie erreicht, ist es höchste Zeit gegenzusteuern.“
Auch hierzu gibt die Studie Handlungsempfehlungen. Für die Unternehmen gelte es, ihre globalen Innovationsnetzwerke aktiv zu gestalten, etwa durch ganzheitliche Standortabwägungen oder systematische Risikoabschätzungen. Besondere Bedeutung komme auch der Gewinnung internationaler Fachkräfte zu. Zudem müssten bestehende Lücken bei der Digitalisierung geschlossen werden. Barta betonte, dass der Verband seine Mitglieder bei diesen Themen und bei der Optimierung ihrer Wertschöpfungsstrukturen unterstütze, „mit dem Ziel, Industriearbeit als wichtigen Bestandteil der Wirtschaftskraft in Baden-Württemberg zu erhalten“.
Darüber hinaus gelte es aber auch, standortsichernde Maßnahmen zu ergreifen. Dabei setze die Studie wichtige Denkanstöße für die Politik, wie etwa die Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation konkret verbessert werden können. So müsse Innovation z.B. durch weniger Bürokratie und schnellere Genehmigungen beschleunigt werden. Es gehe aber auch um generelle Standortfaktoren wie die digitale Infrastruktu r, eine wettbewerbsfähige Energieversorgung oder die Fachkräftesicherung, so Barta: „Wir werden aber auch nicht darum herumkommen, über die Arbeitskosten zu sprechen – sowohl über die immer weiter steigenden Sozialversicherungsbeiträge, als auch über die reinen Lohnkosten. Sie sind inzwischen so hoch, dass sie selbst gut bezahlte Innovationsarbeit hierzulande zunehmend erschweren.“
Zur Studie:
Für die Studie wurden zwischen Mai und Juni 2025 insgesamt 240 Unternehmen aus der M+E-Industrie zur Entwicklung der internationalen Lokalisierung industrieller Innovationsaktivitäten befragt. An der Online-Befragung beteiligten sich vor allem Geschäftsführungen und das C-Level-Management. Die große Mehrheit der befragten Unternehmen stammt aus Baden-Württemberg.
Die Studie wurde von zwei Steinbeis-Transferzentren durchgeführt. Die Autoren sind:
- Prof. Dr. Steffen Kinkel, Leiter des Steinbeis Transferzentrums „Vernetzte Wertschöpfung und Innovation“ (Karlsruhe)
- Prof. Dr. Christoph Zanker, Leiter des Steinbeis Transferzentrums „Industrielles Innovations- und Transformationsmanagement“ (Nürtingen)